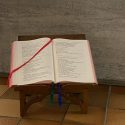2 Kor 5,20-6,2 + Mt 6,1-6.16-18
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche!
Gestern stand ein kleiner frühlingshafter Blumengruß vor meiner Tür – einen Tag zu früh – aber passend in der Farbe Lila. Die heute beginnende Vorbereitungszeit auf Ostern zeigt sich auch in dieser liturgischen Farbe –violett. Mit dieser Farbe violett, der Farbe der Fastenzeit und der österlichen Bußzeit möchte ich eine Predigtreihe beginnen: Violett – eine der sechs Farben, aus denen ein Regenbogen besteht – eine Farbe aus der Fülle der Farben, der Fülle des Lebens und des erfüllten Lebens. Violett, gilt als Farbe des Geistes und der Spiritualität. Sie soll das seelische Gleichgewicht und die Entschlusskraft fördern und hat eine stark meditative Wirkung. Sie beeinflusst das Unterbewusste und dient zur therapeutischen Unterstützung bei tiefenpsychologischen Problemen. Violett ist die Farbe, die zur Ruhe kommen lässt. Die Fastenzeit ist eine stille Zeit nach dem lärmend lauten Fasching und eine Zeit, in der wir uns in diesen unruhigen Kriegszeiten Waffenruhe und Frieden wünschen und dafür beten. Dieser Wunsch nach äußerer Ruhe und Frieden korrespondiert mit dem Wunsch nach innerer Ruhe, nach Entschleunigung, nach innerem Frieden und Zufriedenheit.
Die drei Grundhaltungen gelebter Glaubenspraxis, Fasten, Beten und der Dienst am Nächsten, wie sie Jesus im Evangelium am Aschermittwoch (vgl. Mt 6,1-6.16-18) empfiehlt, können zu dieser inneren Ruhe beitragen:
Das Fasten betrifft mein Ich – es ist keine Einladung zur Diät oder zum Abnehmen. Darum geht’s wirklich: Ich soll mir selbst und meiner Bedürfnisse bewusst werden. Was brauche ich wirklich zum Leben? Worauf kann ich verzichten? Durch Verzicht soll ich erkennen, was alles nicht lebensnotwendig ist und mich und mein Leben oft unnötig belastet.
Durch den Verzicht werde ich offen – offen für Gott. Ich nehme mir bewusst Zeit fürs Gebet und pflege, ja erneuere so meine Gottesbeziehung. Ich darf mich wieder neu auf Gott einlassen, ihn als menschenfreundlichen und liebenden Gott erkennen, als einen, der mich annimmt mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Fehlern und Schwächen. Violett steht für die spirituelle Vertiefung – also genau passend zu diesem Anliegen der Fastenzeit.
Durch den Verzicht werde ich offen – offen auch für meine Mitmenschen. Das Almosengeben drückt meine sorgende Beziehung zu meinen Nächsten aus, zu den Menschen, die mich und meine Hilfe in Wort und Tat nötig haben – jetzt gerade die Menschen in der Ukraine. Mit Almosen ist nicht nur meine finanzielle Hilfe und Spendenbereitschaft gemeint, sondern auch meine tätige und zupackende Hilfe, eben dort, wo ich gebraucht werde.
Das Doppelgebot der Liebe fasst diese dreifache Bezogenheit jedes Menschen auf das eigene Ich, auf das göttliche Du und auf das mitmenschliche Du in folgende Worte: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst (Mt 22, 37-39). Die Worte Jesu zeigen mir, dass Gottes-, Selbst und Nächstenliebe gleichrangig sind. Ich kann nicht das eine durch das andere ersetzen, denn sonst gerät mein Leben in Schieflage. Wenn ich nur an die anderen denke und nie an mich selbst, dann reibe ich mich letzten Endes auf. Wenn ich nur Gebet und Gottesdienst für wichtig halte, verstoße ich gegen das Gebot der tätigen Nächstenliebe, die Jesus den Jüngern mit der Fußwaschung aufgetragen hat. Wenn ich nur an mich denke, fehlt mir der Halt im Leben, den Gott und der Glaube mir geben können. Es gilt, in den kommenden Tagen alle drei Beziehungen neu zu überdenken.
Es gilt, umzukehren und sich neu auszurichten, um wieder die Balance der Beziehungen zu finden und so die Wandlung zu einem österlichen Menschen zu vollziehen. Da violett die Farbe ist, die mit Reinigungs- und Umkehrprozessen verbunden ist – ist sie auch da die passende Farbe: für die Umkehr im privaten Bereich wie auch für die die Umkehr, Reinigung und Neuausrichtung im kirchlichen Bereich und überall dort, wo Menschen versagt haben, wo auch Reue und Buße notwendig ist. „Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!“ (2 Kor 5,20).
Mit der Farbe violett und der „Asche auf dem Haupt“ wollen wir als Christen unserem Leben eine Wende geben – dazu werden wir auch aufgefordert: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium“ (Mk 1,15b) – glaubt an das Gute und ändert euer Leben zum Guten. Fangen wir heute damit an ermutigt durch die Farbe violett – die uns durch diese Zeit auf Ostern hin begleitet.