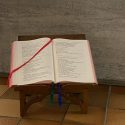PREDIGT 27. SO IM JK (C)
2 Tim 1,6-8.13-14 + Lk 17,5-10
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche!
Können Sie sehen, was ich in der Hand habe (Senfkorn )? Es ist sogar so klein, das ich es zwischen den Fingern halten kann. Meine Finger sind zu groß und der Gegenstand zu klein. Es ist ein kleines Senfkorn – auch ein Korn, das geerntet wurde wie vieles andere auch, wofür wir heute an Erntedank Gott loben. Wir sind dankbar, dass aus kleinen Samenkörnern – gehegt von Gärtnerinnen und Landwirten – große Pflanzen geworden sind und dass vielerorts eine gute und reiche Ernte gereift ist. Gott sei Dank – Erntedank!
Im zweiten Brief schreibt Paulus seinem engen Mitarbeiter Timotheus vom „anvertrauten kostbaren Gut“ (2 Tim 1,14), das uns Menschen in die Hand gegeben ist. Bezogen auf das heutige Erntedank-Fest können wir die „Erde und alles, was auf ihr wächst“ als dieses kostbare Gut anse-hen, für das der Mensch verantwortlich ist (vgl. Gen 1,28-29 bzw. Gen 2,15): behüten, beschützen und bebauen soll der Mensch die Erde – soll seinen Nutzen aus ihr ziehen, aber die Erde und ihre Ressourcen nicht ausnutzen, sondern sie so gebrauchen, dass Lebensräume erhalten werden und auch zukünftige Generationen auf der Erde gut leben können. Uns ist die Erde übergeben. Gott sei Dank – Erntedank!
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schöpfers haben wir die Verantwortung für das zerbrechliche Ökosystem unserer Erde, für den Pflanzen- und Artenreichtum. Die aktuelle Klimakrise zeigt, dass wir schon Jahrzehnte lang die Erde immer mehr ausbeuten, um auf unsere Kosten zu kommen: immer mehr für einzelne Personen und Firmen, Staaten und Kontinente –die Bewältigung der Klimakrise wird uns einiges kosten. „Wir müssten bescheidener werden“ – dazu mahnte Papst Franziskus in seiner vor zehn Jahren veröffentlichten Enzyklika Laudato si; wir müssten „das Notwendige zu teilen, damit Not gewendet wird“ (vgl. LS 52 und v.a. LS 203-221). Ich kaufe einfach ein – und dann kommt bei vielen das große Wegschmeißen. Dabei ist vieles zu gut für die Tonne! Denk mal nach, was du ändern kannst, damit nicht mehr wie in Deutschland durchschnittlich fast 75 kg Lebensmittel pro Person jährlich in die Tonne wandern! Gott sei Dank – Erntedank!
Das „anvertraute kostbare Gut“ (2 Tim 1,14), von dem Paulus schreibt, ist der Glaube, der uns als „kostbare Gut“ wie ein Samenkorn in die Hand gegeben ist: klein, aber voller Entfaltungskraft. Der Glaube kann wachsen, wenn ich ihn wie ein Samenkorn aufgehen, wachsen und reifen lasse – jede und jeder kann viel tun, dass der Glaubenssame aufgeht und wächst: Beten, in der Bibel lesen und darüber sprechen, den Gottesdienst besuchen, anderen helfen, in den Familien den Glauben vorleben und als etwas Positives, Haltgebendes, Tragendes und Tröstendes erlebbar werden lassen. Aber es liegt nicht alles liegt in unserer Hand. Es gilt nicht zu verzagen, sondern auf
Gottes „Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“ (2 Tim 1,7) zu bauen. Er ist der Nährstoff, den ich als zartes „Pflänzchen“ brauche, damit mein Glauben gut wachsen und erstarken kann.
„Alles kann, wer glaubt“ (Mk 9,23) bzw. „Glaube versetzt Berge“, so sagt Jesus: ein winzig kleiner Glaube soll sogar einen fest verwurzelten „Maulbeerbaum“ (Lk 17,6) versetzen können. Also mir ist das beim Kirschbaum in meinem Garten bisher nicht gelungen. Ob ich zu wenig glaube?
Ich glaube nicht – wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, konnte ich auch da Einiges ernten, Früchte des Glaubens nämlich: Liebe und Freude, Geduld – auch wenn mir das oft schwerfiel – dann auch Freundlichkeit und Güte, gelingende Beziehungen und Freundschaften, Treue und Wahrhaftigkeit und noch andere mehr. Schauen Sie doch mal in einer ruhigen Minute im „Garten ihres Lebens“ nach, was es bei Ihnen „auf dem Feld des Glaubens“ (neben so manchem Unkraut) vielleicht besser oder ganz anders gewachsen ist, als anfangs gedacht, was es an Gutem und Nützlichem zu ernten gab und seien Sie dankbar dafür. Gott sei Dank – Erntedank!
Ich glaube, Jesus will uns mit dem Senfkorn-kleinen Glauben sagen, dass es gar nicht so viel braucht, damit etwas Wunderbares entstehen kann; dass mit Glauben und Glaubenskraft in der Kraft des Heiligen Geistes Unmögliches möglich werden kann, so wie es der folgende Satz sagt, der Franz von Assisi zugeschrieben wird: „Tue zuerst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“ AMEN.