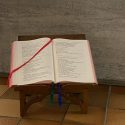PREDIGT CHRISTKÖNIG (A)
Ez 34,11-12.15-17 + Mt 25,31-46
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, liebe Jugendliche!
Mittendrin in der Krise – da ist der Lesungstext aus dem Buch Ezechiel (Ez 34,11-12.15-17) erschreckend aktuell: Das politische und religiöse Versagen der Mächtigen in Kirche und Staat, schwindendes Vertrauen, mangelhafte Führungsstärke. Verantwortungsloses Verhalten der Verantwortlichen zum Leidwesen des Volkes und der Gläubigen – Ezechiel hat die Zerstörung es Landes, die Vertreibung und das Leben im Exil im Blick – und wir?
Viele Bürger sind politikverdrossen; viele Christen gehen zur Kirche auf Distanz oder treten aus – scheinbare Alternativen haben hohen Zulauf.
Mittendrin in der Krise – mitten in gefährlichen Konfliktentwicklungen und problematischen Funktionsstörungen – feiern wir das Christkönigsfest als Zeichen der Hoffnung gegen alle Hoffnungslosigkeit und gegen alle Gleichgültigkeit und Resignation. Der Prophet Ezechiel hält den Mächtigen seiner und unserer Zeit den Spiegel vor: Ein König, der aus der Krise führt; ein König, der nicht von oben herab über die Köpfe hinwegregiert, der nicht unterdrückt, sondern nahbar und da ist – mittendrin in der Krise. Eine Führungspersönlichkeit, die sich nicht wegduckt, sondern sich mit Einsatz und Hingabe sorgt – Gott, der vormacht wie das gehen kann: Macht zum Guten nutzen und sie nicht missbrauchen; Verantwortung wahrnehmen und sich nicht aus der Verantwortung stehlen; sich selbst kümmern und die Anliegen und Rechte der ausgeschlossenen und benachteiligten Menschen zur „Chefsache“ machen – fürsorglich und gerecht, seelsorglich und engagiert. Leitung als Beziehungsgeschehen ist damit ein Einsatz für und nicht ein Regieren über: Zusammenführen und „Verlorenen“ nachgehen, sie zurückholen und zu integrieren versuchen; Verletzungen sehen, Wunden verbinden und zu heilen versuchen; die Sorgen und Nöte des/der Einzelnen kennen und jedem/jeder zugestehen und geben was für ihn/sie individuell Notwendig ist und was er/sie zum Leben braucht – so und nicht anders wird Verantwortung gut wahrgenommen – so und nicht anders können Staats- und Kirchenkrisen, Lebens- und Glaubenskrisen überwunden werden.
Das Christkönigsfest fordert eine Entscheidung von uns, von den Verantwortlichen – es fordert eine Entscheidung von mir, der ich für mein Leben und das Zusammenleben mit anderen Menschen verantwortlich bin. Am Schluss seiner letzten großen Rede und unmittelbar vor der Passion sagt uns Jesus quasi als Quintessenz seiner Botschaft vom Reich Gottes, worauf es ankommt (vgl. Mt 25,31-46), nicht erst wenn er kommt, sondern worauf es ankommt jetzt und hier und heute: Nächstenliebe ist nicht verhandelbar, sie ist nicht optional, sondern sie muss getan werden. Es steht in meiner Verantwortung, durch mein Tun Not zu lindern und eben nicht. Jesus ist da ganz entschieden und klar: Nichts Böses tun, reicht nicht für das Himmelreich, wenn ich das Gute nicht tue, obwohl es mir möglich gewesen wäre. Beim Gericht am Ende der Zeiten gibt es keine Entschuldigung und kein Entrinnen beim Urteil über das, was ich nicht getan habe. Deshalb bekennen wir ja beim Schuldbekenntnis auch, „dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe.“ Aus Liebe soll ich handeln, darauf kommt es an: „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch vertan, worauf es ankommt, wenn er kommt“ (Gotteslob Bamberg 862).
Jesus knüpft die tätige Nächstenliebe an keinerlei Bedingungen. Die Liebe in der Nachfolge Jesu Christi gilt jedem/jeder, auch dem/der, den/die ich nicht leiden kann, „dem Geringsten“ (Mt 25,40.45) – unabhängig auch von Nationalität, Religion, Geschlecht oder Lebensführung. Letztlich entscheiden die „kleinen Dinge“, die ich für andere tue und anderen schenke: ein Bissen Brot, ein Schluck Wasser, ein geteilter Mantel, ein Krankenbesuch, ein gutes, aufbauendes Wort, ein liebevoller Blick, … – hier gilt es nicht kleinlich zu sein, sondern großzügig! In diesem Tun an „den Geringsten“ ereignet sich die Begegnung mit Jesus Christus – ER ist es, mit dem ich wie der hl. Martin den Mantel teile oder wie die hl. Elisabet das Brot.
Das Christkönigsfest setzt Zeichen: Es setzt – gerade in Zeiten der Krise – nicht auf die „Liebe zur Macht“, sondern auf die „Macht der Liebe“, die allen gilt. Christus ist diese Menschgewordene Liebe Gottes; ER verlässt als König seinen „hohen Thron“ im Einsatz für die Menschen, im Einsatz seines Lebens. Das Christkönigsfest ist eine Einladung, mitten in der Krise den Königsweg Jesu Christi zu wählen, den Weg hin zu den Menschen, zu den Armen und Bedürftigen unserer Tage, und zu handeln wie ER. AMEN.