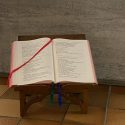PREDIGT ALLERHEILIGEN (A)
Offb 7,2-4.9-14 + Mt 5,1-12a
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, liebe Jugendliche! All Hallows‘ Eve, der Abend vor Allerheiligen, von dieser Bezeichnung ist Halloween abgeleitet, gehört untrennbar zum heutigen Hochfest dazu – wie der Heiligabend zu Weihnachten. Das Fest Allerheiligen gibt es in der katholischen Kirche seit dem 8. Jahrhundert. Christinnen und Christen gedenken der vielen bekannten heiligen Frauen und Männer und auch der vielen namenlosen Heiligen, die nur Gott kennt – Menschen, die ganz unauffällig mitten unter uns gelebt haben. Viele denken bei Halloween an gruselige, furchteinflößende verkleideten Gestalten und sind solchen vielleicht auch gestern begegnet. Allerheiligen und Halloween – wie geht das zusammen?
Die Wurzeln von Halloween liegen im Unklaren, im Dunkeln; allen Hypothesen gemeinsam sind Verbindungen zu außerchristlichen Totenfesten – es geht um die Sterblichkeit und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Alle Religionen suchen Antworten auf diese existentiellen Fragen – auch das Christentum. Halloween, der Vorabend von Allerheiligen, wurde besonders in katholisch gebliebenen Gebieten in Großbritannien und in Irland gefeiert. Einer Sage gemäß lebte dort der Bösewicht Jack Oldfield. Er überlistete den Teufel und kam nicht in den Himmel, aber auch nicht in die Hölle, sondern lebte weiter auf Erden – erinnert mich an den Brandner Kaspar. Für seinen Weg durch die Dunkelheit auf Erden und zur Abwehr der bösen Geister bekam Jack Oldfield ein Licht in einer Rübe, einer Art Kürbis ….
Und was hat das jetzt mit dem katholischen Hochfest Allerheiligen und dem darauffolgenden Allerseelentag zu tun? Ich finde sehr viel!
Mit irischen Auswanderern kam Halloween in die USA und von dort als zum Gruselfest mutierter Re-Import zurück. Ob man an böse Geister glaubt oder nicht, eines ist klar: Das Böse in der Welt ist nicht wegzuleugnen – es ist existent! Wenn Menschen ihre Häuser gruselig schmücken, machen sie das sichtbar, und wenn sie verkleidet umherziehen, bekennen sie letztendlich: Das Böse spukt mitten unter uns – Unrecht und Unfriede, Armut und Hunger, die nicht sein müssten, Lieblosigkeit, Hass, Neid und Streit, Terror, Gewalt und Trauer (vgl. Mt 5,3-10) – wirklich zum Fürchten. Unsere Welt und auch wir sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen „Licht“ für unse-ren Weg durch diese als düster und beängstigend wahrgenommene Zeit – viele Jugendliche haben Zukunftsängste, ergab kürzlich eine Umfrage.
Wir brauchen „Licht“ für unseren Weg – „Licht“, welches uns vom heutigen Hochfest Allerheiligen leuchtet: Es ist das Licht der Hoffnung, Licht, das vom auferstandenen Christus kommt. ER scheint hinein in die Erlösungsbedürftigkeit unseres Lebens und unserer Zeit. Auch die Lich-ter auf den Gräbern unserer Verstorbenen, derer wir beim Besuch der Friedhöfe gedenken, sind Lichter dieser österlichen Hoffnung.
Die Heiligen sind schon im Licht bei Jesus Christus. Sie haben durch ihr vorbildliches Leben aus dem Glauben wegweisendes Licht für andere Menschen verbreitet. Jesus Christus war ihr Licht auch im Leben. Sie selbst waren wie eine Glasscheibe, durch die Jesus Christus, die Mensch gewordene Liebe Gottes, hineinleuchtetet in diese Welt – durchsichtig auf Gott hin. Das Leben der Heiligen war „besiegelt“ (vgl. Offb 7,2-4) – sie gehörten zu Jesus Christus. Sie waren besiegelt durch die Taufe – hineingetauft in Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Berufen zu einem Leben aus dem Glauben, zu einem Leben, das mit dem Tod nicht endet, sondern hinüberführt zum ewigen Leben – zum Licht und zur Freude in Jesus Christus.
Die Heiligen waren Sünder, nicht alles war makellos – wie auch bei uns und unseren Verstorbenen. Sie waren und wir sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen keine Angst zu haben – die hat uns leider über Jahrhunderte die Kirche mit dem Fegefeuer gemacht. Auch hier will ich „Licht“ ins Dunkel bringen: Das Fegefeuer ist kein Ort der Strafe, sondern ein Ort der Hoffnung; ein Ort, der in der Begegnung mit Christus himmelfähig macht, wo das Schlechte, Sündhafte und Böse weggebrannt wird wie mit einem Desinfektionsmittel bei einer Wunde/Verletzung: Es brennt zwar, aber es dient der Heilwerdung und Heil(ig)ung – oder mit den Worten der Lesung: „sie haben ihre [düsteren und gruseligen] Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht“ (Offb 7,14). Das Strahlen des Allerheiligenfestes, die Leuchtkraft der Heiligen und das österliche Licht des Auferstandenen weisen uns und den Weg zum Ziel: zum Leben in Jesus Christus. AMEN.