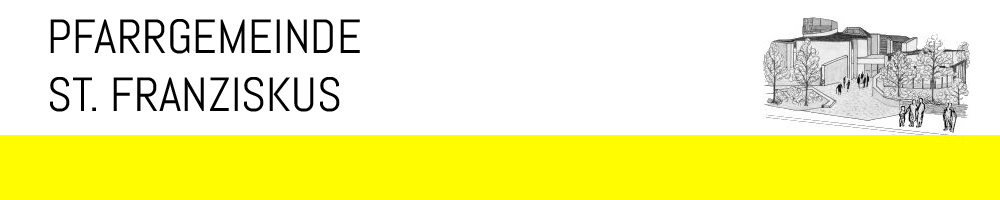PREDIGT 28. SONNTAG Im JK (C)
2 Kön 5,14-17 + Lk 17,11-19 (Apfel)
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche!
Ich habe Euch/Ihnen heute was zur Kerwa/zum Gottesdienst mitgebracht: einen Apfel. So ein Apfel lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen beim Gedanken an einen leckeren Apfelstrudel mit Vanillesoße. Viele schon verführte ein knackig-saftiger Apfel: zum Reinbeißen lecker. Adam und Eva ließen sich von einer köstlichen Frucht verführen – ein trügerischer Genuss, der für Adam und Eva letztendlich nicht ohne Folgen blieb. Wir sind vorsichtiger geworden. Wir schauen vorher nach, ob im Apfel „der Wurm“ drin ist. Schon bei der Apfelernte werden heruntergefallene und angeschlagene Äpfel gleich aussortiert. Von ihnen droht Ansteckungsgefahr, denn sie faulen schnell – für eine Lagerung mitten unter „gesunden“ Äpfeln ist da kein Platz. Und doch sagt so ein makellos schön anzusehender Apfel noch nichts über seine inneren Werte, über seinen Geschmack, die Konsistenz des Fruchtkörpers oder über seinen Vitamingehalt. Wir sehen einem Apfel nicht an, was in ihm steckt. Ob er teigig, mehlig oder saftig ist, das merken wir erst beim Essen. Und häufig schneiden wir dabei noch das Wertvollste weg, die Vitamine, von denen die meisten direkt unter der Schale sitzen. Sie sitzen dort, wo wir sie am wenigsten vermuten: ganz außen, in der Grenzregion des Apfels, abgegrenzt vom Kerngehäuse.
In der Grenzregion zwischen Galiläa und Samarien hält sich Jesus auf (vgl. Lk 17,11): Er ist als Grenzgänger unterwegs, weitab vom galiläischen Kernland. Im Grenzgebiet grenzen sich Menschen voneinander ab und werden ausgegrenzt: in den Augen der Juden, die im Zentrum, in Galiläa leben, sind Samariter keine Kinder Israels. In ihren Augen sind sie schlechte Menschen, die Gott falsch anbeten und falsche Meinungen vertreten. Grenzwertige Feindbilder werden stilisiert und über Generationen vererbt: statt Einheit und Integration, ablehnende Abgrenzung und Isolation.
Jesus geht an diese Grenze und trifft zehn Aussätzige. Sie sind durch Lepra und andere Hautkrankheiten entstellt und daher von der Gesellschaft und vom Gottesdienst ausgegrenzt. Ein Leben lang isoliert ohne mitmenschlichen Kontakt halten die Ausgegrenzten Abstand – mehr als 1,5 Meter. Aus sicherer Entfernung betteln sie Vorbeikommende an: Habt Erbarmen mit uns! (vgl. Lk 17,13) Vorbeikommende haben sicher schnell ein Geldstück hingeworfen und das Weite gesucht: Nur schnell weg von ihnen, um eine Ansteckung um jeden Preis zu verhindern. Das wollte keiner: Aussätzig sein, lebenslang ausgegrenzt, ohne Zugehörigkeit zur guten Gesellschaft.
Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! (Lk 17,13) Als Jesus sie sieht, sucht er nicht das Weite, er ruft sie vielmehr zur Umkehr auf: Geht, zeigt euch den Priestern! (Lk 17,14) Im Vertrauen auf Jesus gehen die Bittsteller – und im Umkehren werden sie rein, werden sie von ihrer oberflächlichen Hautkrankheit geheilt. Die Priester als Gesundheitskontrolleure, als Wächter der kultischen Reinheit und über den Tempelkult, können dies nur bestätigen.
Nur einer der Geheilten kehrt zu Jesus um, um Gott zu danken. Bitten und betteln konnten sie alle, aber danken? Danken ist keine Selbstverständlichkeit. Danken ist ein Zeichen menschlicher Reife. Wer „Danke“ sagt, bekennt, dass es einen gibt, dem er etwas verdankt – letztlich ist es Gott, der in und durch Jesus wirkt. „Gott sei Dank“ sagt ausgerechnet ein (in den Augen der Juden) Andersgläubiger, ein Samariter; er ist der dankbare Samariter. Er ist nicht nur oberflächlich wieder gesellschaftsfähig geworden, sondern auch innerlich geheilt, versöhnt mit Gott, den er dafür lobt und dankt.
Gut aussehen und gut dastehen. Darauf kommt es vielen an in einer Gesellschaft, die aufs Äußere und Oberflächliche bedacht ist. Nörgeln und kritisieren, andere ausgrenzen und schlechtreden, gehört heutzutage (auch in der Kirche) für viele Menschen zum scheinbar guten Ton, nur um selbst gut dazustehen. Bitten und betteln kann jede(r) von uns, aber danken?
Wir feiern heute erneut Erntedank – als Dank für menschliche Reife. Angesichts der Vielfalt an Menschen, kann jede(r) dankbar sein für alle Mitmenschen, statt vorschnell auszusortieren und auszugrenzen – eine Gemeinde die offen ist, für alle, die da sind, das ist Kirche im Sinne Jesu. Er war da für alle Menschen. Jesus lädt mich ein zur Umkehr: zur Abkehr von aller Oberflächlichkeit und zur Hinwendung zu den Mitmenschen und zu Gott. So können wir menschlich reifen und „Danke“ sagen. Und vielleicht entdecken wir bei der Suche nach Dankenswertem wertvolle Menschen und Begegnungen gerade dort, wo wir es nie vermutet hätten – wie beim Apfel, bei dem die wertvollen Vitamine direkt unter der Schale sitzen. AMEN.