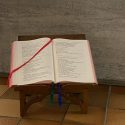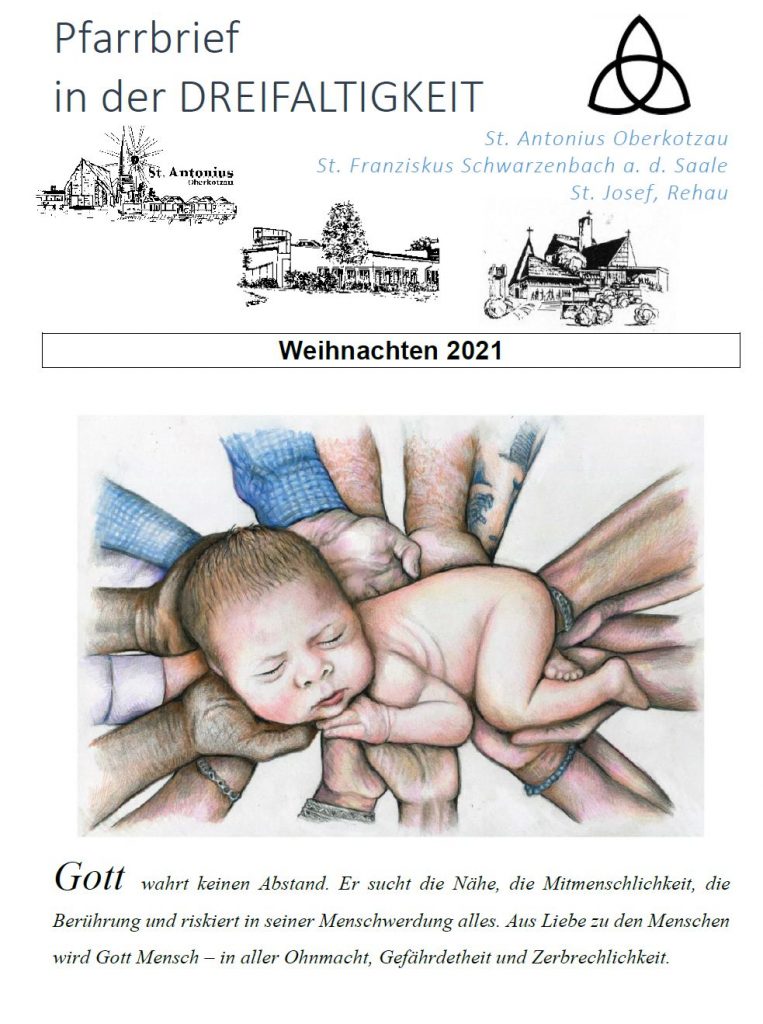PREDIGT 2. SO NACH WEIHNACHTEN (C)
Eph 1,3-6.15-18 + Joh 1,1-5.9-14
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche!
Wir feiern an Weihnachten, dass Gott Mensch wird und es braucht Zeit, das zu begreifen: der große Gott macht sich klein, wird ein Kind, fängt an wie wir als hilfloses Neugeborenes. Johannes schreibt anders: Gottes Wort wird Fleisch, geht in Fleisch und Blut über und hat unter den Menschen gewohnt. Zum dritten Mal hören wir die Worte des Johannesprologs: Am ersten Weihnachtsfeiertag war er als Evangelium dran, ebenso an Silvester und auch heute am 2. Sonntag nach Weihnachten. Der Johannesprolog (Joh 1,1-18 bzw. Joh 1,1-5.9-14) fasst nicht nur die Menschwerdung Gottes in Worte, sondern auch die „Gottwerdung“ des Men-schen – nicht auf die Weise, dass wir Menschen „vergöttern“, sie „in den Himmel heben“ wie Pop- der Fußballstars, oder Models und Idolen nacheifern – auch nicht auf die Weise, dass wir uns „zu Gott machen“ – dieser Versuchung das eigene Ich absolut setzten und zu „Gott“ zu erklären, erliegen viele: Ich habe die Macht. Mein Wille zählt. Ich will meine Freiheit. Weihnachten und Menschwerdung ist anders: das Du ist entscheidend. Dass Gott Mensch wird, zeigt, dass er uns Menschen ernst- und annimmt und uns anspricht im Schrei eines Neugeborenen: Ich liebe dich, Mensch, als meinen Bruder / meine Schwester, als Mitmensch. Dieses menschgewordene Wort Gottes will eine Antwort – meine Antwort. Ich soll darauf antworten, ob ich mit dem menschlichen Gott in Beziehung treten will – nicht oberflächlich oder auf einen unverbindlichen Kontakt angelegt, sondern dauerhaft.
„Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“
(Joh 1,12-13)
Gott schenkt Macht – Gott gibt von seiner Macht ab.
Wir Menschen definieren Macht als Fähigkeit oder Möglichkeit etwas zu tun. Viele beziehen das auf den zwischenmenschlichen Bereich: ich will Macht ausüben; ich will jemanden beherrschen. Wenn Menschen so in Be-ziehungen oder auf die Suche nach einem Partner gehen, dann klappt es nicht – denn mit Liebe hat eine derartige Beziehung, Partnerschaft und Ehe nichts zu tun. Wer den menschgewordenen Gott aufnimmt, erhält eine Macht – nicht die Liebe zur Macht, sondern die Macht der Liebe.
Diese Macht der Liebe setzt nicht ihren Willen durch – schon gar nicht mit Gewalt oder Drohung. Es geht nicht darum, andere dem eigenen Willen und Wollen zu unterwerfen, sondern frei zu werden und zu sein – aus Liebe. Aus freien Stücken und ohne Hintergedanken Ja zueinander sagen und auch Ja zu Gott, das ist es. Sie kommen hoffentlich nicht zum Gottesdienst, weil sie müssen, oder weil Sie glauben, mir damit einen Gefallen zu tun. Nein, hoffentlich kommen Sie zum Gottesdienst in aller Freiheit und aus Liebe zu Gott – eine Liebesbeziehung, die gepflegt und gelebt werden will.
Gott lädt uns dazu ein, wieder neu zu entdecken, dass wir in der Taufe „aus Gott geboren“ sind. Das hat Konsequenzen: Wir dürfen und sollen als Kin-der Gottes leben. Wir können an Gott und an die in Jesus Christus mensch-gewordene Liebe Gottes glauben. Genau das meint „Gottwerden“: Hinein-genommensein in diese Liebe Gottes, die mir in Fleisch und Blut übergehen und in mir Mensch werden will, damit ich menschlicher und mitmenschli-cher werde durch Gottes Liebe. Mach’s wie Gott: Werde Mensch. AMEN.